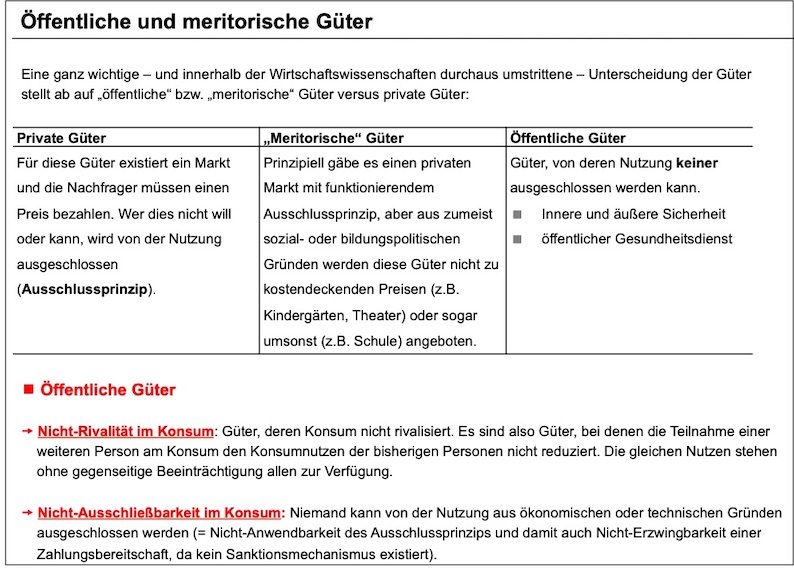Ich hatte in der Vorlesung kurz darauf hingewiesen, dass man die Bibel bzw. Teile davon durchaus als ein volkswirtschaftliches Lehrbuch lesen und interpretieren kann. Natürlich in der diesem Sammelband entsprechenden ganz eigenen Sprache, aber es kommt ja auf die Inhalte an.
Beispielsweise findet man im Alten Testament durchaus eine Vorstellung von dem, was wir als Konjunkturzyklus besprochen haben, also vereinfacht gesagt das Auf und Ab der wirtschaftlichen Entwicklung. In der Bibel wird von den „sieben fetten und den sieben mageren Jahren“ gesprochen. Das müssen wir uns einmal genauer anschauen. Zugleich ist das wirklich ein ökonomisches Lehrstück, was ich Ihnen hier berichten kann.